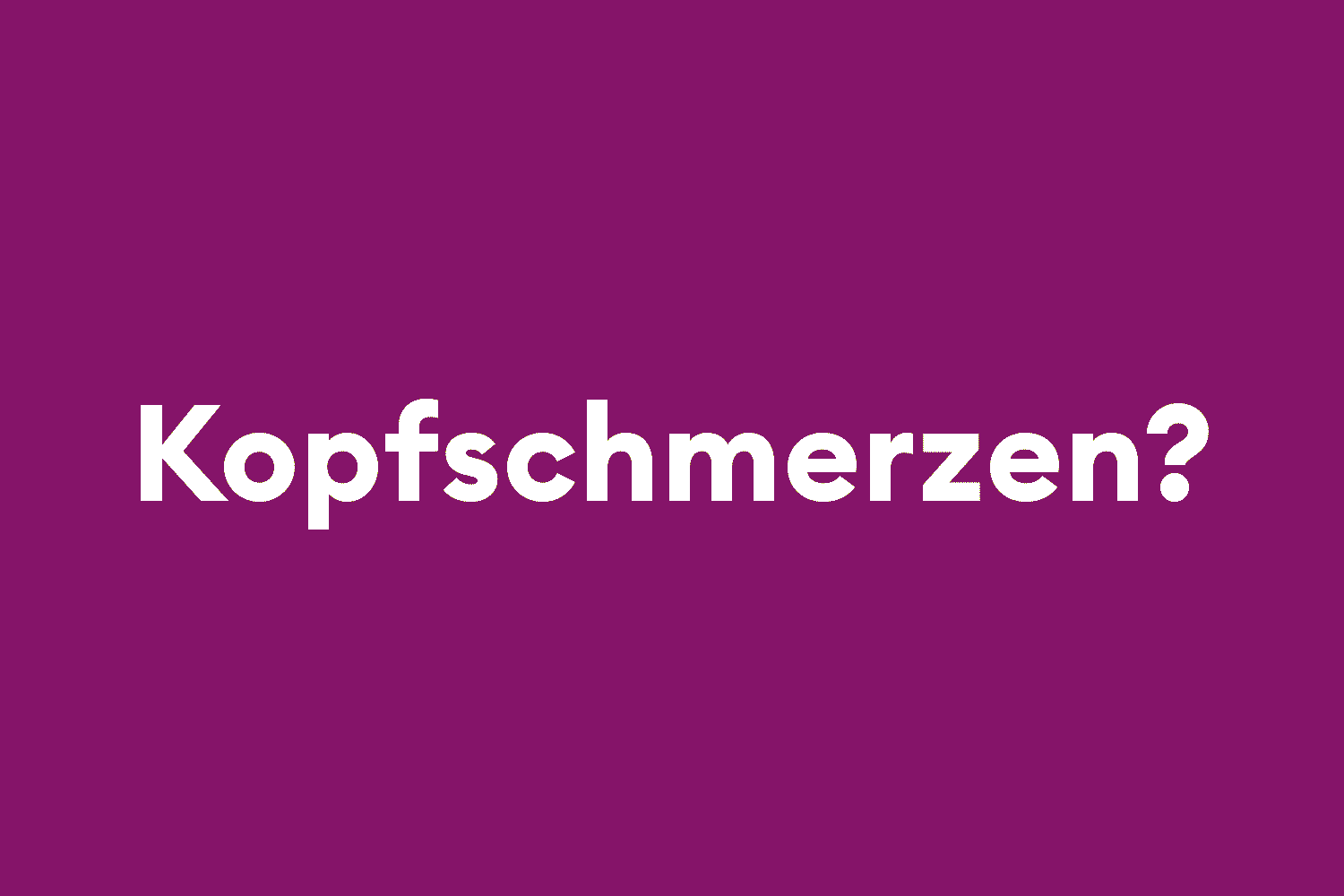Das Aarauer Kultur- und Gesellschaftsleben fand im 19. Jahrhundert unter erschwerten oder gar unwürdigen Bedingungen statt. Zwar stand ab 1831 das Casino (heute Bezirksgerichtsgebäude) zur Verfügung, für Konzerte, Theateraufführungen oder Versammlungen musste man aber mehrheitlich auf Säle im «Ochsen» am Schlossplatz oder im «Schwert» an der Rathausgasse (heute Möbelhaus Strebel), auf den reichlich engen Schwurgerichtssaal im dritten Stock des Rathauses oder auf die bescheidene Bühne in der Tuchlaube, direkt über dem städtischen Schlachthaus, zurückgreifen. Alles andere als ideal, beklagten sich doch Besucher, dass «das Vieh seine Klagetöne in die Exklamationen der Schauspieler und Sänger einfallen lässt».
 Metzgergasse/Städtischer Schlachthaus Tuchlaube, 1889
Metzgergasse/Städtischer Schlachthaus Tuchlaube, 1889
Bereits um 1850 regten sich deshalb in Aarau Kräfte, die dieser pitoyablen Situation eine Ende bereiten wollten. Es erklang der Ruf nach einem der Kantonshauptstadt würdigen „Gesellschaftshaus“ und einem „öffentlichen Versammlungslokal“. Doch es dauerte noch weitere 25 Jahre, ehe sich der Stadtrat zu einem erfolgversprechenden Anlauf entschloss. Anno 1876 installierte die Behörde für ein solches Projekt einen „Bausubventionsfonds“, der unter anderem mit jährlich 2000 Franken aus der Polizeikasse alimentiert werden sollte. Im übrigen betonte die Stadtregierung mehrfach, dass der öffentlichen Hand schlicht die Mittel fehlten, um ein derart aufwändiges Vorhaben allein zu stemmen. Also griff die Bürgerschaft zur Selbsthilfe und äufnete dank grossen und kleinen Spenden den «Saalbaufonds» kontinuierlich auf mehr als 100 000 Franken.
Nicht genug damit, neben den Finanzen stritt man sich in Aarau auch um die künftige Platzierung eines Saalbaus. 1881 hatte der Stadtrat genug und beantragte dem Souverän, als Standort das Areal der alten Kaserne im einstigen Salzhaus am Schlossplatz zu bestimmen und ein Kostendach von 200 000 Franken zu beschliessen. Die anschliessende Sommer-Gmeind reduzierte die Bausumme auf 130 000 Franken, erhöhte aber gleichzeitig das Fassungsvermögen im kleinen und grossen Saal auf insgesamt 1200 Personen. Eine Rechnung, die nach Adam Riese nicht aufgehen konnte. Die Exekutive beharrte auf einer Investition von 200 000 Franken und erhielt schliesslich an der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 1882 – nach einer Redeschlacht, die bis Mitternacht dauerte – grünes Licht. Dank der privaten Geldsammlung, die rund 60 Prozent der Kosten einbrachte, konnte der Stadtrat die letzten Zweifler mit dem Hinweis überzeugen, dass eine Erhöhung des Steuerfusses für die Saalbau-Finanzierung nicht nötig sei.
Bereits am 14. Juli des gleichen Jahres, am Maienzug, erfolgte die feierliche Grundsteinlegung, knapp anderthalb Jahre später stand die Eröffnung mit Ansprachen, Bankett, Konzerten der städtischen Musikvereine und einem finalen Ball samt Polonaise auf dem Programm.

Innenansicht Saalbau, August 1889
1928 hätte die Stadt nach dem Abbruch des benachbarten Gasthofs zum Goldenen Ochsen die Chance gehabt, den Saalbau zu vergrössern, doch einmal mehr fehlte es am nötigen Geld. So begnügte man sich mit kleineren Anpassungen und Renovationen, ehe man sich dann mitte der 1990er zu einer umfassenden Sanierung und Erweiterung (unter Einbezug der ehemaligen «Ochsen»-Scheune) entschloss, zum stolzen Preis von knapp 25 Millionen Franken.
Im heutigen Kultur- und Kongresshaus (KuK), das vor bald zwei Jahrzehnten den Begriff des etwas biederen Saalbaus ersetzt hat, kann man oberhalb des Eingangs zum Saal 2 eine auf den ersten Blick seltsame Inschrift entdecken: «Eine Schwadron, ein Storch, ein Ochse …». Zur Erklärung: Schwadron bezieht sich auf eine Einheit der Kavallerie, die von 1850 bis 1972 ihren Waffenplatz in Aarau hatte. Vor dem Bezug der (heute noch stehenden) Reithalle ritten die Dragoner in einer alten Theaterbude, die am Schlossplatz stand. «Storchen» und «Ochsen» erinnern an zwei historische Gasthöfe, die in unmittelbarer Nähe vom alten Saalbau gestanden hatten, aber längst verschwunden sind.
 Metzgergasse/Städtischer Schlachthaus Tuchlaube, 1889
Metzgergasse/Städtischer Schlachthaus Tuchlaube, 1889Bürger griffen zur Selbsthilfe
Bereits um 1850 regten sich deshalb in Aarau Kräfte, die dieser pitoyablen Situation eine Ende bereiten wollten. Es erklang der Ruf nach einem der Kantonshauptstadt würdigen „Gesellschaftshaus“ und einem „öffentlichen Versammlungslokal“. Doch es dauerte noch weitere 25 Jahre, ehe sich der Stadtrat zu einem erfolgversprechenden Anlauf entschloss. Anno 1876 installierte die Behörde für ein solches Projekt einen „Bausubventionsfonds“, der unter anderem mit jährlich 2000 Franken aus der Polizeikasse alimentiert werden sollte. Im übrigen betonte die Stadtregierung mehrfach, dass der öffentlichen Hand schlicht die Mittel fehlten, um ein derart aufwändiges Vorhaben allein zu stemmen. Also griff die Bürgerschaft zur Selbsthilfe und äufnete dank grossen und kleinen Spenden den «Saalbaufonds» kontinuierlich auf mehr als 100 000 Franken.
Bau-Entscheid fiel erst 1882
Nicht genug damit, neben den Finanzen stritt man sich in Aarau auch um die künftige Platzierung eines Saalbaus. 1881 hatte der Stadtrat genug und beantragte dem Souverän, als Standort das Areal der alten Kaserne im einstigen Salzhaus am Schlossplatz zu bestimmen und ein Kostendach von 200 000 Franken zu beschliessen. Die anschliessende Sommer-Gmeind reduzierte die Bausumme auf 130 000 Franken, erhöhte aber gleichzeitig das Fassungsvermögen im kleinen und grossen Saal auf insgesamt 1200 Personen. Eine Rechnung, die nach Adam Riese nicht aufgehen konnte. Die Exekutive beharrte auf einer Investition von 200 000 Franken und erhielt schliesslich an der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 1882 – nach einer Redeschlacht, die bis Mitternacht dauerte – grünes Licht. Dank der privaten Geldsammlung, die rund 60 Prozent der Kosten einbrachte, konnte der Stadtrat die letzten Zweifler mit dem Hinweis überzeugen, dass eine Erhöhung des Steuerfusses für die Saalbau-Finanzierung nicht nötig sei.
Bereits am 14. Juli des gleichen Jahres, am Maienzug, erfolgte die feierliche Grundsteinlegung, knapp anderthalb Jahre später stand die Eröffnung mit Ansprachen, Bankett, Konzerten der städtischen Musikvereine und einem finalen Ball samt Polonaise auf dem Programm.

Innenansicht Saalbau, August 1889
Eine seltsame Inschrift im KuK
1928 hätte die Stadt nach dem Abbruch des benachbarten Gasthofs zum Goldenen Ochsen die Chance gehabt, den Saalbau zu vergrössern, doch einmal mehr fehlte es am nötigen Geld. So begnügte man sich mit kleineren Anpassungen und Renovationen, ehe man sich dann mitte der 1990er zu einer umfassenden Sanierung und Erweiterung (unter Einbezug der ehemaligen «Ochsen»-Scheune) entschloss, zum stolzen Preis von knapp 25 Millionen Franken.
Im heutigen Kultur- und Kongresshaus (KuK), das vor bald zwei Jahrzehnten den Begriff des etwas biederen Saalbaus ersetzt hat, kann man oberhalb des Eingangs zum Saal 2 eine auf den ersten Blick seltsame Inschrift entdecken: «Eine Schwadron, ein Storch, ein Ochse …». Zur Erklärung: Schwadron bezieht sich auf eine Einheit der Kavallerie, die von 1850 bis 1972 ihren Waffenplatz in Aarau hatte. Vor dem Bezug der (heute noch stehenden) Reithalle ritten die Dragoner in einer alten Theaterbude, die am Schlossplatz stand. «Storchen» und «Ochsen» erinnern an zwei historische Gasthöfe, die in unmittelbarer Nähe vom alten Saalbau gestanden hatten, aber längst verschwunden sind.
Titelbild: Saalbau mit Mühle 1918
Über
Zeitreise
We Love Aarau macht jeden Monat mit Geschichten und Anekdoten eine Reise ins vergangene Aarau.
Hermann Rauber, 68, ist Historiker und Journalist. Nach seiner Pensionierung ist er noch lange nicht schreibmüde, arbeitet für verschiedene Publikationen und ist als Stadtführer tätig. Am liebsten sind ihm dabei Geschichten über die Gaststätten und das frühere Nachtleben in Aarau.