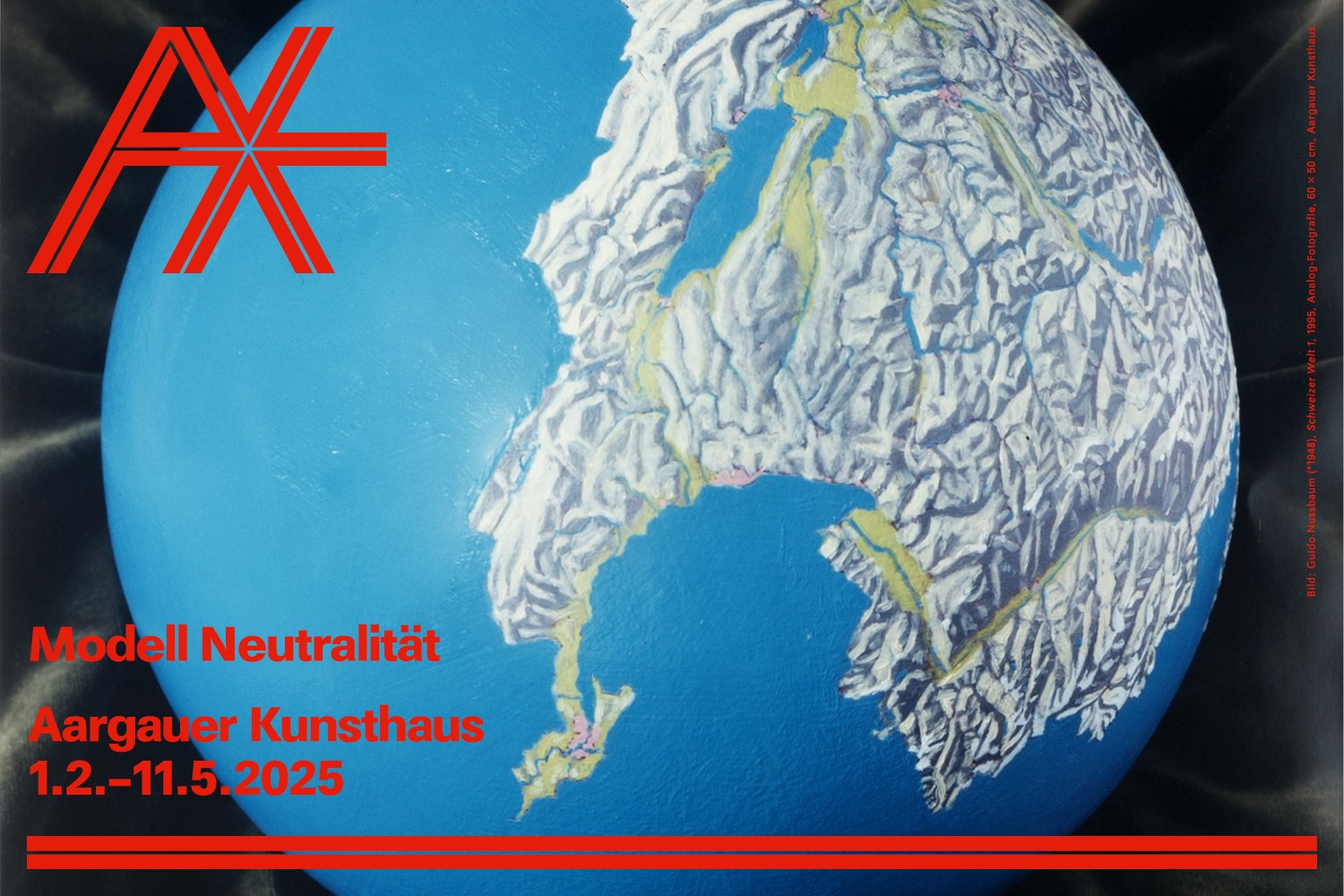Dass der uns heute noch vertraute Wochenmarkt schon vor Jahrhunderten an einem Samstag stattgefunden haben muss, zeigt eine Urkunde von 1679. Die Rede ist dort von Heinrich Rychner, Gabriel Hassler und Rudolf Hagnauer, von drei Aarauer Messerschmieden, die von Schultheiss und Rat den Auftrag hatten, abwechselnd «jeweils am Markt am Samstag einen Mann zum Zuschleifen (von Schneidwerkzeugen) zu stellen». Allerdings war das Feilbieten von Waren für den täglichen Gebrauch nur Männern mit Bürgerrecht oder Wohnsitz in Aarau erlaubt.
Das bunte Treiben fand damals noch im südlichen Teil der heutigen Rathausgasse (gegen den Oberturm hin) statt, der bis ins 19. Jahrhundert treffend Marktgasse hiess. Neben Gemüse, Früchten, Brot und Fleisch waren auch Fische im Angebot. Diese konnten sich «im grossen Becken des Brunnens um die bunte Säule tummeln», der früher von einem geharnischten Krieger, später von der barocken Justitia geschmückt war. Der Gerechtigkeitsbrunnen steht heute auf dem Kirchplatz, früher markierte er das Strassenkreuz Rathausgasse-Kirchgasse-Kronengasse, befand sich also zwischen dem heutigen Restaurant Laterne und dem Laden des Rolling Rock.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts lagerte man den Wochenmarkt von der Altstadt an den 1820 von Kettensträflingen in Zwangsarbeit aufgefüllten Stadtgraben aus. Das galt auch für die Jahrmärkte, die sich am christlichen Heiligenkalender orientierten. So gab es zum Beispiel Märkte um den Johannestag (24. Juni), am Jakobstag (25. Juli), am Gallustag (16. Oktober), an Martini (11. November) oder am Thomastag (21. Dezember). Am Jahrmarkt konnten die Städter Waren und Produkte kaufen, die man nicht alle Tage vor der Haustüre erstehen konnte. Im Angebot waren Werkzeuge, Tücher und Stoffe, Felle, Seifen, Kämme oder Spezereien aus fernen Ländern, namentlich Gewürze.
Bei diesen Jahrmärkten (heute Monatsmärkte) waren ausdrücklich auch fremde Krämer oder «Krätzenträger» zugelassen, ganz im Gegensatz zum Wochenmarkt, an dem Händler und Hausierer bei Strafe ausgeschlossen waren. Das änderte mit der Gründung des liberalen Kantons Aargau 1803. Nun durften auch die Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung in Aarau für den Nachschub an frischen Nahrungsmitteln sorgen und sich damit einen Batzen verdienen. So war ab 1820 der Graben jeweils stark besetzt mit Küttiger «Chaisen», die im Herbst besonders herzhafte Rüebli garantierten.
Neben dem monatlichen Waren- existierte am gleichen Tag (jeweils am dritten Mittwoch im Monat) auch ein Viehmarkt, der aber räumlich getrennt im vorderen Schachen stattfand. Hier konnten die Landwirte aus der näheren Umgebung Kühe, Rinder, Stiere, Ziegen oder Schafe kaufen. Den Handel besiegelte man nach altem Brauch mit einem Handschlag, als Zahlungsmittel galt noch lange der «Napoléon d’or» (Goldmünze zu 20 Franken) oder «Näppel», wie er im Volksmund genannt wurde. Angeschlossen war schliesslich auch ein weitherum bekannter und beliebter «Säulimärt», der an der schattigen Schachenallee die Fortsetzung des Viehmarktes bildete. Natürlich diente der Anlass auch der Kontaktpflege unter den Bauern, traf man sich doch zum Znüni oder zum Mittagessen in den nahen Wirtschaften und tat sich an Kutteln oder Suppe mit Spatz und ordentlich Tranksame gütlich.
Waren es in den 1940er Jahren noch bis zu 200 Stück Grossvieh, die zum Kauf angeboten wurden, verlor sich die Bedeutung des Aarauer Viehmarktes zusehends. Die letzte Lebendauffuhr ging im Schachen am 16. Dezember 1986 über die Bühne. An die gute alte Zeit erinnert heute nur noch der Name «Viehmarktplatz», allerdings stehen dort nicht mehr Ochsen, sondern Autos. Gehalten hat sich auch die Bezeichnung «Holzmarkt» am oberen Graben, obwohl dort schon lange nicht mehr Brennbares zum Kauf angeboten wird.
Fische im Justitia-Brunnen
Das bunte Treiben fand damals noch im südlichen Teil der heutigen Rathausgasse (gegen den Oberturm hin) statt, der bis ins 19. Jahrhundert treffend Marktgasse hiess. Neben Gemüse, Früchten, Brot und Fleisch waren auch Fische im Angebot. Diese konnten sich «im grossen Becken des Brunnens um die bunte Säule tummeln», der früher von einem geharnischten Krieger, später von der barocken Justitia geschmückt war. Der Gerechtigkeitsbrunnen steht heute auf dem Kirchplatz, früher markierte er das Strassenkreuz Rathausgasse-Kirchgasse-Kronengasse, befand sich also zwischen dem heutigen Restaurant Laterne und dem Laden des Rolling Rock.
Stoffe und Gewürze am Jahrmarkt
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts lagerte man den Wochenmarkt von der Altstadt an den 1820 von Kettensträflingen in Zwangsarbeit aufgefüllten Stadtgraben aus. Das galt auch für die Jahrmärkte, die sich am christlichen Heiligenkalender orientierten. So gab es zum Beispiel Märkte um den Johannestag (24. Juni), am Jakobstag (25. Juli), am Gallustag (16. Oktober), an Martini (11. November) oder am Thomastag (21. Dezember). Am Jahrmarkt konnten die Städter Waren und Produkte kaufen, die man nicht alle Tage vor der Haustüre erstehen konnte. Im Angebot waren Werkzeuge, Tücher und Stoffe, Felle, Seifen, Kämme oder Spezereien aus fernen Ländern, namentlich Gewürze.
Bei diesen Jahrmärkten (heute Monatsmärkte) waren ausdrücklich auch fremde Krämer oder «Krätzenträger» zugelassen, ganz im Gegensatz zum Wochenmarkt, an dem Händler und Hausierer bei Strafe ausgeschlossen waren. Das änderte mit der Gründung des liberalen Kantons Aargau 1803. Nun durften auch die Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung in Aarau für den Nachschub an frischen Nahrungsmitteln sorgen und sich damit einen Batzen verdienen. So war ab 1820 der Graben jeweils stark besetzt mit Küttiger «Chaisen», die im Herbst besonders herzhafte Rüebli garantierten.
Kuhhandel im Schachen
Neben dem monatlichen Waren- existierte am gleichen Tag (jeweils am dritten Mittwoch im Monat) auch ein Viehmarkt, der aber räumlich getrennt im vorderen Schachen stattfand. Hier konnten die Landwirte aus der näheren Umgebung Kühe, Rinder, Stiere, Ziegen oder Schafe kaufen. Den Handel besiegelte man nach altem Brauch mit einem Handschlag, als Zahlungsmittel galt noch lange der «Napoléon d’or» (Goldmünze zu 20 Franken) oder «Näppel», wie er im Volksmund genannt wurde. Angeschlossen war schliesslich auch ein weitherum bekannter und beliebter «Säulimärt», der an der schattigen Schachenallee die Fortsetzung des Viehmarktes bildete. Natürlich diente der Anlass auch der Kontaktpflege unter den Bauern, traf man sich doch zum Znüni oder zum Mittagessen in den nahen Wirtschaften und tat sich an Kutteln oder Suppe mit Spatz und ordentlich Tranksame gütlich.
Waren es in den 1940er Jahren noch bis zu 200 Stück Grossvieh, die zum Kauf angeboten wurden, verlor sich die Bedeutung des Aarauer Viehmarktes zusehends. Die letzte Lebendauffuhr ging im Schachen am 16. Dezember 1986 über die Bühne. An die gute alte Zeit erinnert heute nur noch der Name «Viehmarktplatz», allerdings stehen dort nicht mehr Ochsen, sondern Autos. Gehalten hat sich auch die Bezeichnung «Holzmarkt» am oberen Graben, obwohl dort schon lange nicht mehr Brennbares zum Kauf angeboten wird.
Bild: Der «Säulimärt» im Schachen um 1910.
Über
Zeitreise
We Love Aarau macht jeden Monat mit Geschichten und Anekdoten eine Reise ins vergangene Aarau.
Hermann Rauber, 67, ist Historiker und Journalist. Nach seiner Pensionierung ist er noch lange nicht schreibmüde, arbeitet für verschiedene Publikationen und ist als Stadtführer tätig. Am liebsten sind ihm dabei Geschichten über die Gaststätten und das frühere Nachtleben in Aarau.