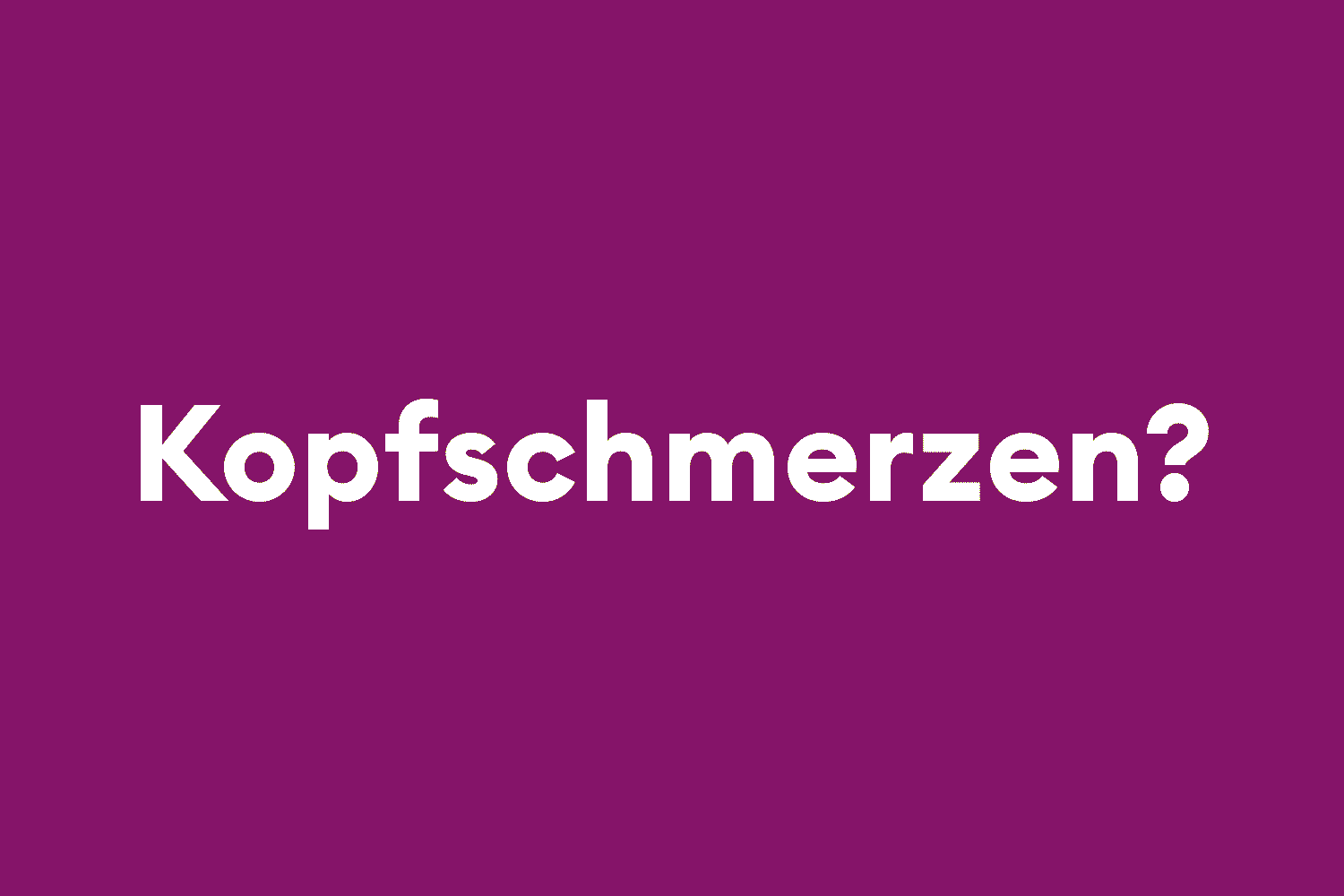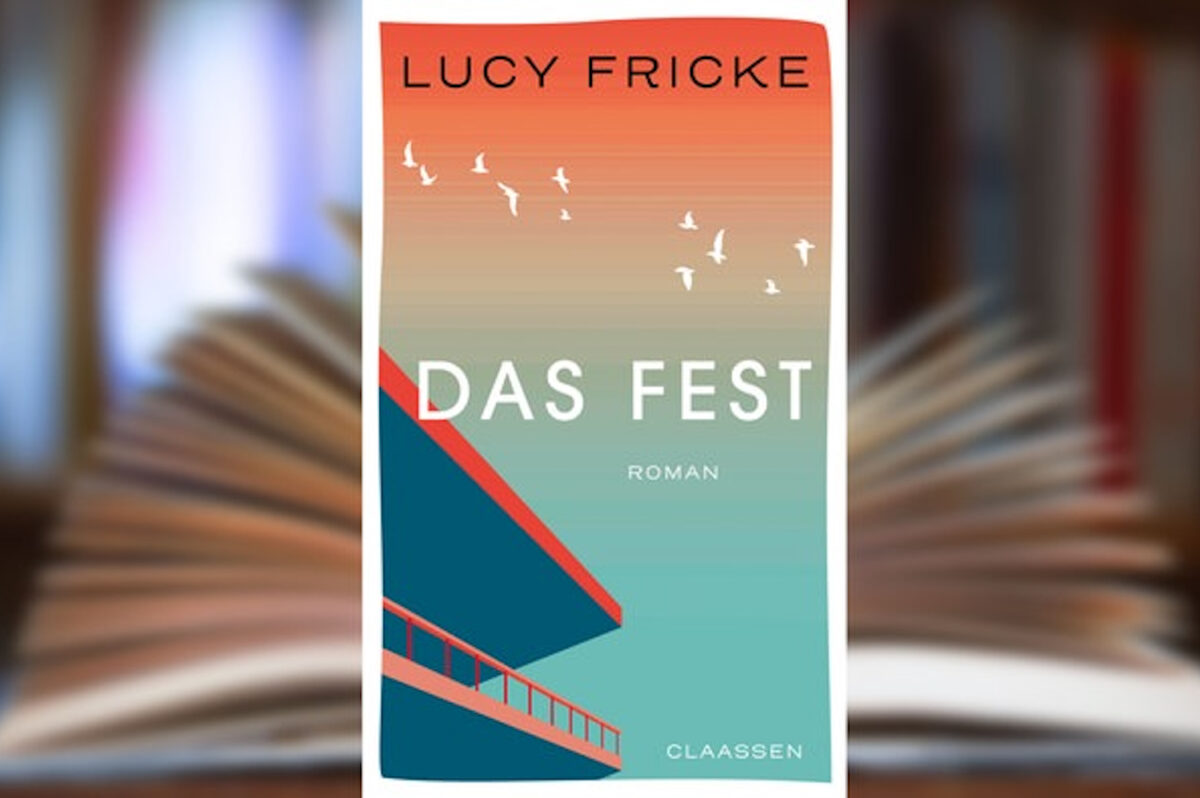Aarau zählte vor 130 Jahren etwas mehr als 6000 Einwohner, die mündlich von Angesicht zu Angesicht oder schriftlich kommunizierten. Die meisten empfanden das Telefon als «neumödischen Firlefanz» und waren technisch überfordert. Trotzdem startete das Aarauer Telefonnetz mit 88 Anschlüssen, auf denen im ersten Betriebsjahr 1887 rund 35 000 Lokalgespräche geordert wurden. Ein Telefonverzeichnis gab es noch nicht, weil eine Direktwahl technisch nicht möglich war. Den ersten Telefonanschluss in der Aargauer Kantonshauptstadt erhielt die Jura-Cement-Fabrik an der Aare, die Stadtverwaltung folgte erst an 42. Stelle.
Von einem «Siegeszug» des Telefons konnte in den Pionierzeiten also keineswegs die Rede sein. Das galt nicht nur für die privaten Haushalte, sondern explizit auch für die Behörden. Die städtischen Gemeindeväter reagierten unwirsch und machten öffentlich geltend, dass «der lokale Telefonverkehr keinem dringenden Bedürfnis» entspreche, sondern einen «unnötigen Luxus» darstelle. Kein Wunder, dass sich die Telefondichte in Aarau um 1890 bei knapp 3 Prozent bewegte.
Mit dieser negativen Einstellung verpflichtete die Stadt die Abonnenten, «die übrigen Hausbewohner nur in dringenden Fällen telefonieren zu lassen». Auch die Mehrzahl der Geschäftsinhaber verhielt sich dem neuen Mittel der Kommunikation gegenüber zurückhaltend. Kaum jemand mochte sich für etwas zu erwärmen, «das Geld kostete, ohne einen Nutzen abzuwerfen». Denn das Warten auf eine Telefonverbindung über das Amt konnte dauern, im Falle eines internationalen Gesprächs musste man mit drei bis vier Stunden rechnen. In den ersten Jahren war die Zentrale nur von morgens 7 bis abends um 19 Uhr besetzt, ehe mit steigender Nachfrage ein «durchgehender Nachtdienst» eingeführt wurde. Und von Aarau aus führten nach und nach direkte Drahtverbindungen nach Zürich, Basel, Bern und Luzern, nach Winterthur und Schöftland.
Weil sich die damalige Aarauer Hauptpost am Bahnhofplatz und damit in peripherer Lage befand, installierte man die erste Telefonzentrale im Obergeschoss der Postfiliale im alten Kaufhaus, mitten in der Altstadt. Hier liefen die Freileitungen, die vom weithin sichtbaren «Telefontürmchen» über die Dächer und entlang der Strassen ausstrahlten, zusammen. Weil eine solche Übertragung anfällig war, entstanden ab 1898 die ersten unterirdischen Kabelanlagen. Und mit dem Bezug der neuen Hauptpost anno 1915 durften die rund 20 Telefonistinnen nun in einer modernen Multipelzentrale arbeiten, mit einer Kapazität von 1000 lokalen Anschlüssen. Es dauerte dann aber noch bis ins Jahr 1939, bis sich die Aarauer Abonnenten ohne Umweg über die Zentrale selber direkt anrufen konnten. Für Ferngespräche aber musste man sich noch bis weit in die 1960er Jahre an das Amt wenden und wurde dort von Hand gestöpselt.
«Luxus, kein dringendes Bedürfnis»
Von einem «Siegeszug» des Telefons konnte in den Pionierzeiten also keineswegs die Rede sein. Das galt nicht nur für die privaten Haushalte, sondern explizit auch für die Behörden. Die städtischen Gemeindeväter reagierten unwirsch und machten öffentlich geltend, dass «der lokale Telefonverkehr keinem dringenden Bedürfnis» entspreche, sondern einen «unnötigen Luxus» darstelle. Kein Wunder, dass sich die Telefondichte in Aarau um 1890 bei knapp 3 Prozent bewegte.
Mit dieser negativen Einstellung verpflichtete die Stadt die Abonnenten, «die übrigen Hausbewohner nur in dringenden Fällen telefonieren zu lassen». Auch die Mehrzahl der Geschäftsinhaber verhielt sich dem neuen Mittel der Kommunikation gegenüber zurückhaltend. Kaum jemand mochte sich für etwas zu erwärmen, «das Geld kostete, ohne einen Nutzen abzuwerfen». Denn das Warten auf eine Telefonverbindung über das Amt konnte dauern, im Falle eines internationalen Gesprächs musste man mit drei bis vier Stunden rechnen. In den ersten Jahren war die Zentrale nur von morgens 7 bis abends um 19 Uhr besetzt, ehe mit steigender Nachfrage ein «durchgehender Nachtdienst» eingeführt wurde. Und von Aarau aus führten nach und nach direkte Drahtverbindungen nach Zürich, Basel, Bern und Luzern, nach Winterthur und Schöftland.
Telefontürmchen auf dem Kaufhaus
Weil sich die damalige Aarauer Hauptpost am Bahnhofplatz und damit in peripherer Lage befand, installierte man die erste Telefonzentrale im Obergeschoss der Postfiliale im alten Kaufhaus, mitten in der Altstadt. Hier liefen die Freileitungen, die vom weithin sichtbaren «Telefontürmchen» über die Dächer und entlang der Strassen ausstrahlten, zusammen. Weil eine solche Übertragung anfällig war, entstanden ab 1898 die ersten unterirdischen Kabelanlagen. Und mit dem Bezug der neuen Hauptpost anno 1915 durften die rund 20 Telefonistinnen nun in einer modernen Multipelzentrale arbeiten, mit einer Kapazität von 1000 lokalen Anschlüssen. Es dauerte dann aber noch bis ins Jahr 1939, bis sich die Aarauer Abonnenten ohne Umweg über die Zentrale selber direkt anrufen konnten. Für Ferngespräche aber musste man sich noch bis weit in die 1960er Jahre an das Amt wenden und wurde dort von Hand gestöpselt.
Titelbild: Kronengasse gegen Osten, 29.8.1889, Gysi & Co.
Über
Zeitreise
We Love Aarau macht jeden Monat mit Geschichten und Anekdoten eine Reise ins vergangene Aarau.
Hermann Rauber, 68, ist Historiker und Journalist. Nach seiner Pensionierung ist er noch lange nicht schreibmüde, arbeitet für verschiedene Publikationen und ist als Stadtführer tätig. Am liebsten sind ihm dabei Geschichten über die Gaststätten und das frühere Nachtleben in Aarau.