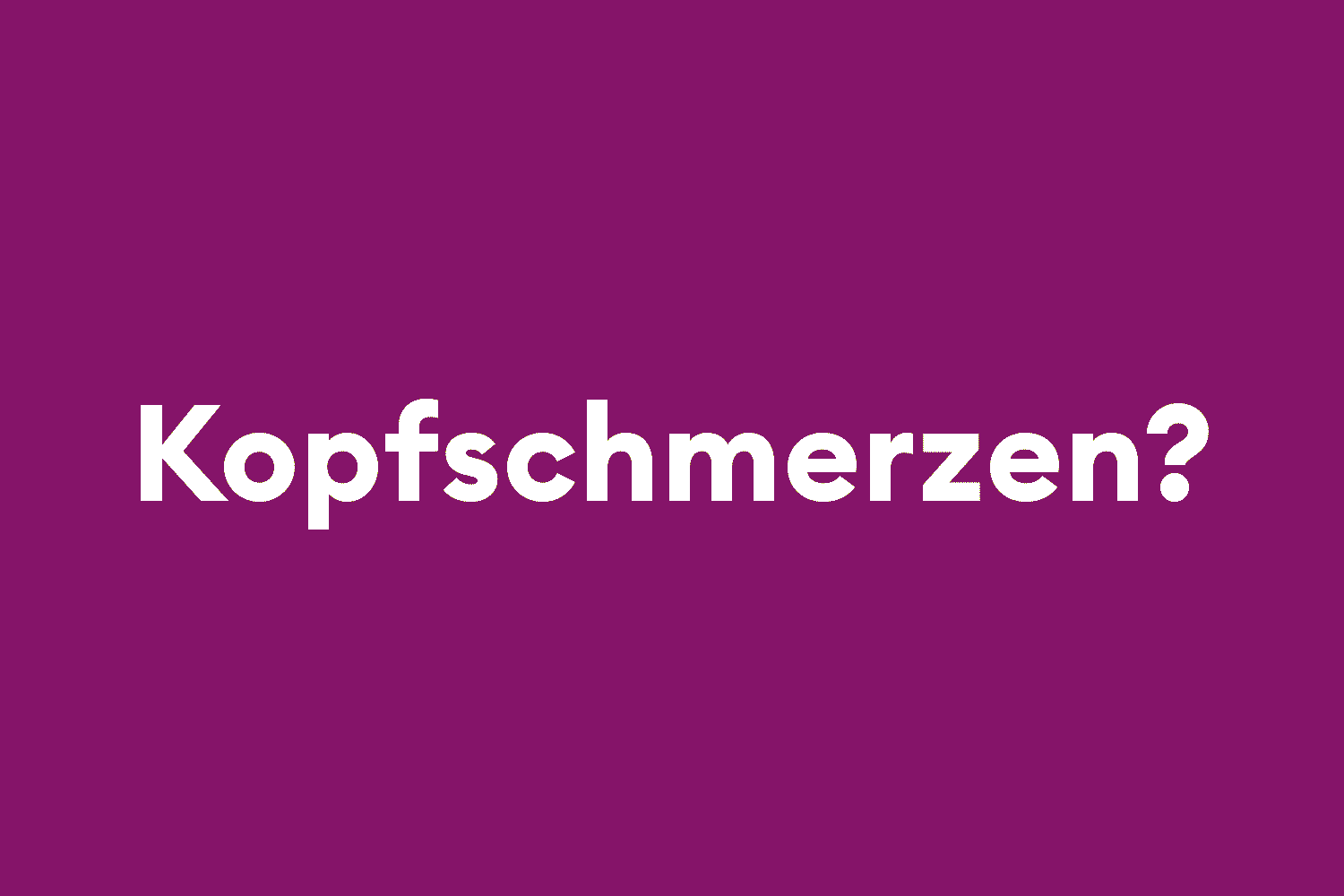Starten wir unsere Tour beim Restaurant Weinberg, dem ältesten aus Stein gemauerten Gebäude nördlich der Aare. Über dem Eingang prangt die Jahrzahl 1615, das Haus dürfte seinerzeit eng mit dem Weinbau verknüpft gewesen sein, diente im 19. Jahrhundert aber als Bierbrauerei. Ein spezielles Bijou ist der angebaute Tanzsaal aus dem Jahre 1879 mit seinen Jugendstil-Elementen. Ab 1914 quartierte sich im «Weinberg» Militär ein. Aus dem Bierkeller wurde im Ersten Weltkrieg ein Notspital, noch heute existiert der Schlüssel mit dem Messingschild «Weinberg Spital».
Über die untere Weinbergstrasse gewinnen wir an Höhe. Noch vor gut einhundert Jahren wären wir mitten in Rebstöcken gestanden. Trauben reiften hier schon kurz nach der Stadtgründung 1248, erst am Ende des 19. Jahrhunderts hatte diese Herrlichkeit wegen der in ganz Europa grassierenden Reblaus ein Ende. Damit begann die sukzessive Überbauung des Aarauer Sonnenhangs, der sich zu einer bevorzugten Wohnlage entwickelte. Wir biegen rechter Hand in die untere Hungerbergstrasse ein und rätseln über diesen Flurnamen. Früher glaubte man, der Begriff leite sich von «Ungarnberg» ab und erinnere an die Einfälle der Magyaren im 8. Und 9. Jahrhundert. Doch näher liegt die Erklärung, dass man unter «Hungerberg» die Bezeichnung eines «trockenen, steinigen Bodens» versteht.
Der Aufstieg zum Alpenzeiger ist steil, aber letztlich lohnenswert. Hier führte im 19. Jahrhundert die Meyersche Promenade vorbei, auf der die Bürgerschaft im Biedermeier lustwandeln konnte, genauso wie auf dem Balänenweg im Osten oder auf der Schanz-Promenade im Westen. Doch wie kam es zum «Alpenzeiger»? Im Juni 1865 bereicherte man das «Känzeli» mit einer halbrunden Plattform aus Metall, die im Relief das Alpenpanorama enthält. Mit einem beweglichen Zeiger konnte man (und kann es heute noch) die Berggipfel anpeilen und identifizieren, sofern die Fernsicht stimmt. Andernfalls ist allein schon der Blick auf die Stadt und Region eine Augenweide. Der alte Alpenzeiger wurde 1975 durch eine neue und moderne Tafel ersetzt, ein Geschenk der Firma Sprecher + Schuh zum 75jährigen Bestehen.
Wir gehen weiter auf einem Waldweg in nördlicher Richtung bis zum Rombächli und folgen dem munter plätschernden Wasser hinab bis zum Wendeplatz am Ende des Erzgrubenwegs. Woher stammt dieser Name? Er verweist auf den im Jura damals verbreiteten Abbau von Eisenerz, der im 18. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte. Bekannt sind aus jener Zeit der Lindgraben (Rombach-Küttigen), das Gebiet Buech (Erlinsbach) oder der Meyerstollen am Hungerberg. Immer wieder gab es Streit um Geld und Wald, weil der Bergbau sehr viel Holz verbrauchte. In unserer Gegend existierte keine eigene Verhüttung, das eisenhaltige Gestein musste auf der Aare an den Hochrhein transportiert werden, entweder nach Albbruck-Dogern oder nach Wehr, wo entsprechende Öfen in Betrieb waren.

Küttigerstrasse, 1925
Aus wirtschaftlichen Gründen kam der Bergbau nach 1820 zum Erliegen. Hin und wieder kommt es im Bereich der verlassenen unterirdischen Minen zu Bodenabsenkungen. Letztmals passierte dies im Dezember 2013, als sich auf einem Waldweg im Buech zwischen Küttigen und Erlinsbach ein Loch öffnete. Weiter geht die Reise über das Tannengut an die Küttigerstrasse. Dort steht rechter Hand das Haus zum Kirschgarten, in dem sich vor zweihundert Jahren die «Zimmermann’sche Tafelrunde» befand, eine vorwiegend von Intellektuellen frequentierte «Chüechli-Wirtschaft». Hier soll auch Jeremias Gotthelf getafelt haben, als er an einer Theologen-Tagung teilnahm.
Gegenüber vom Kirschgarten erhebt sich die alte Bally-Schuhfabrik mit Baujahr 1860, mit ihrer Lage an der Staffeleggstrasse ideal für die Arbeiter aus den nahen Juradörfern. Anno 1896 waren hier 337 Angestellte beschäftigt. Nur einen Steinwurf entfernt grüsst den Wanderer schliesslich die Villa Blumenhalde, das ehemalige Wohnhaus von Heinrich Zschokke aus dem Jahr 1818, in dem der Universalgelehrte als Volksaufklärer, Staatsmann und Pädagoge ungestört seine Tätigkeit entfalten konnte und zahlreiche führende Köpfe aus ganz Europa empfing.
1959 kaufte die Ortsbürgergemeinde Aarau der Industriellenfamilie Oehler die Blumenhalde ab und stellte sie der Öffentlichkeit zur Verfügung, erst als Didaktikum (kantonale Fortbildungsstätte für Lehrkräfte der Bezirksschule), seit 2009 als Sitz des Zentrums für Demokratie, eine Aussenstelle der Universität Zürich. Damit endet die historische Wanderung nördlich der Aare, hoffentlich mit einem kühlen Trunk im lauschigen Biergarten im Restaurant Weinberg.
Was bedeutet der Name Hungerberg?
Über die untere Weinbergstrasse gewinnen wir an Höhe. Noch vor gut einhundert Jahren wären wir mitten in Rebstöcken gestanden. Trauben reiften hier schon kurz nach der Stadtgründung 1248, erst am Ende des 19. Jahrhunderts hatte diese Herrlichkeit wegen der in ganz Europa grassierenden Reblaus ein Ende. Damit begann die sukzessive Überbauung des Aarauer Sonnenhangs, der sich zu einer bevorzugten Wohnlage entwickelte. Wir biegen rechter Hand in die untere Hungerbergstrasse ein und rätseln über diesen Flurnamen. Früher glaubte man, der Begriff leite sich von «Ungarnberg» ab und erinnere an die Einfälle der Magyaren im 8. Und 9. Jahrhundert. Doch näher liegt die Erklärung, dass man unter «Hungerberg» die Bezeichnung eines «trockenen, steinigen Bodens» versteht.
Panorama auf dem Alpenzeiger
Der Aufstieg zum Alpenzeiger ist steil, aber letztlich lohnenswert. Hier führte im 19. Jahrhundert die Meyersche Promenade vorbei, auf der die Bürgerschaft im Biedermeier lustwandeln konnte, genauso wie auf dem Balänenweg im Osten oder auf der Schanz-Promenade im Westen. Doch wie kam es zum «Alpenzeiger»? Im Juni 1865 bereicherte man das «Känzeli» mit einer halbrunden Plattform aus Metall, die im Relief das Alpenpanorama enthält. Mit einem beweglichen Zeiger konnte man (und kann es heute noch) die Berggipfel anpeilen und identifizieren, sofern die Fernsicht stimmt. Andernfalls ist allein schon der Blick auf die Stadt und Region eine Augenweide. Der alte Alpenzeiger wurde 1975 durch eine neue und moderne Tafel ersetzt, ein Geschenk der Firma Sprecher + Schuh zum 75jährigen Bestehen.
Erinnerung an den Eisenerzabbau
Wir gehen weiter auf einem Waldweg in nördlicher Richtung bis zum Rombächli und folgen dem munter plätschernden Wasser hinab bis zum Wendeplatz am Ende des Erzgrubenwegs. Woher stammt dieser Name? Er verweist auf den im Jura damals verbreiteten Abbau von Eisenerz, der im 18. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte. Bekannt sind aus jener Zeit der Lindgraben (Rombach-Küttigen), das Gebiet Buech (Erlinsbach) oder der Meyerstollen am Hungerberg. Immer wieder gab es Streit um Geld und Wald, weil der Bergbau sehr viel Holz verbrauchte. In unserer Gegend existierte keine eigene Verhüttung, das eisenhaltige Gestein musste auf der Aare an den Hochrhein transportiert werden, entweder nach Albbruck-Dogern oder nach Wehr, wo entsprechende Öfen in Betrieb waren.

Küttigerstrasse, 1925
Aus wirtschaftlichen Gründen kam der Bergbau nach 1820 zum Erliegen. Hin und wieder kommt es im Bereich der verlassenen unterirdischen Minen zu Bodenabsenkungen. Letztmals passierte dies im Dezember 2013, als sich auf einem Waldweg im Buech zwischen Küttigen und Erlinsbach ein Loch öffnete. Weiter geht die Reise über das Tannengut an die Küttigerstrasse. Dort steht rechter Hand das Haus zum Kirschgarten, in dem sich vor zweihundert Jahren die «Zimmermann’sche Tafelrunde» befand, eine vorwiegend von Intellektuellen frequentierte «Chüechli-Wirtschaft». Hier soll auch Jeremias Gotthelf getafelt haben, als er an einer Theologen-Tagung teilnahm.
Blick auf die Villa Blumenhalde
Gegenüber vom Kirschgarten erhebt sich die alte Bally-Schuhfabrik mit Baujahr 1860, mit ihrer Lage an der Staffeleggstrasse ideal für die Arbeiter aus den nahen Juradörfern. Anno 1896 waren hier 337 Angestellte beschäftigt. Nur einen Steinwurf entfernt grüsst den Wanderer schliesslich die Villa Blumenhalde, das ehemalige Wohnhaus von Heinrich Zschokke aus dem Jahr 1818, in dem der Universalgelehrte als Volksaufklärer, Staatsmann und Pädagoge ungestört seine Tätigkeit entfalten konnte und zahlreiche führende Köpfe aus ganz Europa empfing.
1959 kaufte die Ortsbürgergemeinde Aarau der Industriellenfamilie Oehler die Blumenhalde ab und stellte sie der Öffentlichkeit zur Verfügung, erst als Didaktikum (kantonale Fortbildungsstätte für Lehrkräfte der Bezirksschule), seit 2009 als Sitz des Zentrums für Demokratie, eine Aussenstelle der Universität Zürich. Damit endet die historische Wanderung nördlich der Aare, hoffentlich mit einem kühlen Trunk im lauschigen Biergarten im Restaurant Weinberg.
Über
Zeitreise
We Love Aarau macht jeden Monat mit Geschichten und Anekdoten eine Reise ins vergangene Aarau.
Hermann Rauber, 70, ist Historiker und Journalist. Nach seiner Pensionierung ist er noch lange nicht schreibmüde, arbeitet für verschiedene Publikationen und ist als Stadtführer tätig. Am liebsten sind ihm dabei Geschichten über die Gaststätten und das frühere Nachtleben in Aarau.